
(Co-)Regulation über den Körper:
Wie funktioniert das?
Als Eltern brauchen wir sie genauso wie als Musiker:innen auf der Bühne: die Fähigkeit, Stress-Signale des Körpers zu deuten und darauf Einfluss zu nehmen. Diese "Regulation" können wir lernen – nicht nur "für das Musizieren", sondern auch "durch Musizieren". Wie das geht und wie wir unsere Ausgeglichenheit an unsere Kinder – oder unser Publikum – weitergeben können, bespreche ich mit Traumatherapeutin Kati Bohnet.
Stefanie: Der Begriff „Regulation“ wird immer populärer, wird aber auch oft missverstanden. Erklär doch bitte noch einmal: Was ist Regulation eigentlich genau?
Kati:
Gerne. Regulation ist im Grunde das, was der Körper ständig tut – ein autonomer Prozess, den wir nicht bewusst steuern können.
Beispielsweise können wir nicht bewusst beeinflussen, wie Brokkoli durch den Darm wandert. Genauso wenig können wir sagen: „Blutdruck, geh mal runter“ oder „Entspann dich jetzt“. Das sind autonome Abläufe.
Regulation umfasst sowohl körperliche als auch emotionale Vorgänge. Wir können nicht einfach entscheiden, ein bestimmtes Gefühl nicht zu empfinden – etwa Wut oder Angst.
Was ist Co-Regulation?
Selbstregulation und Co-Regulation gehören zusammen wie Henne und Ei.
Denn die Fähigkeit zur Selbstregulation entwickelt sich in der Kindheit aus der Erfahrung, von einer vertrauten Bindungsperson co-reguliert zu werden. So lernen wir, dass wir sicher in einem sozialen Gefühle aufgefangen werden.
Unser Körper kann dann Alarm- und Stresssignale beruhigen. Diese Fähigkeit können wir über Co-Regulation dann an andere weitergeben, indem wir selbst Sicherheit vermitteln: etwa über ein offenes Ohr, beruhigenden Körperkontakt, einfach nur "da sein"– oder eben Musik. (1) (2)
Das ganze Interview als Video
Stefanie: Das kennen viele – etwa wenn man Lampenfieber hat oder wenn man wütend wird, weil das eigene Kind wütend ist. Das sind klassische Situationen.
Kati: Genau. Ein häufiges Missverständnis ist, dass Regulation mit Selbstkontrolle gleichgesetzt wird – also etwas, das wir willentlich tun. Aber Regulation geschieht unbewusst. Und ein zweiter Irrtum ist, dass Regulation immer mit Ruhe gleichgesetzt wird.
Dabei bedeutet reguliert zu sein nicht, ständig ruhig zu sein, sondern flexibel auf Situationen reagieren zu können – etwa wütend zu werden, wenn es angebracht ist, und dann auch wieder runterzukommen.
Das ist das eigentliche Ziel: Die Fähigkeit, emotionale Wellen zu „surfen“.
Buch-Tipp:
Nervenstark verbunden
In Katis neuem Buch "Nervenstark verbunden" geht es um die Rolle des Nervensystems, der Co- und Selbstregulation in der Begleitung von Kindern als Eltern oder Bezugspersonen.
Hier findet ihr das Buch in ihrem Verlag Droemer Knaur.
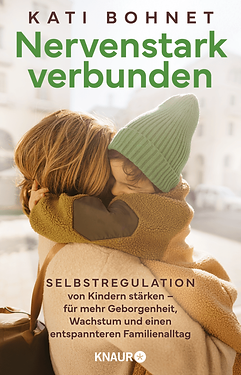
Stefanie:
Vielleicht kann man sagen: Nicht wir regulieren uns, sondern der Körper reguliert uns– wie beim Hungergefühl.
Kati:
Genau. Und wenn wir verstehen, wie der Körper das tut – etwa mit Nervensystemwissen –, können wir indirekt Einfluss nehmen. Wenn ich z. B. tanze oder schwimme, erhöht sich automatisch meine Herzfrequenz und Atmung.
Da kann ich also durch mein Verhalten auch mein Nervensystem beeinflussen. Aber so einfach ist es leider nicht immer. Auch Sicherheit spielt eine zentrale Rolle. Wenn wir wissen, was in uns den „inneren Alarm“ auslöst, können wir gezielt darauf einwirken.
Stefanie:
Das heißt, wir sind unserem Stress nicht ausgeliefert – wenn wir unseren Körper besser verstehen, können wir Einfluss nehmen.
Kati:
Genau. Unsere Gedanken („Es ist alles gut“) haben zwar eine Wirkung, aber deutlich weniger als körperliche Signale. 80 % der Nervenbahnen des Vagusnerves laufen vom Körper zum Gehirn – und nur 20 % in die andere Richtung. Daher wirken körperorientierte Ansätze („bottom-up“) so stark.
"Unseren Herzschlag, unsere Stimme, die Spannung unserer Haut … all das bekommt unser Gegenüber mit – und andersrum genauso. Wie co- oder dysregulieren uns die gesamte Zeit. Jedes Nervensystem hat Einfluss auf das Gegenüber.“
Singen oder Musizieren helfen ja auch dabei, sich zu regulieren. Warum genau?
Kati:
Das hat viel mit der Polyvagal-Theorie von Stephen Porges zu tun. Der ventrale Vagusnerv – Teil des parasympathischen Nervensystems – ist unser soziales Kontaktsystem.
Er verläuft u. a. durch alle Organe oberhalb des Zwerchfells, also auch durch den Zungenansatz, Gaumen, Stimmbänder bis zum Herzen. Wenn wir singen oder summen, werden diese Strukturen aktiviert – und das Nervensystem erhält bottom-up ein Signal von Sicherheit.
Singen wirkt also direkt beruhigend. Wenn wir in Gruppen musizieren, kommt der Aspekt von sozialer Verbundenheit und Rhythmus dazu – auch das hat einen regulierenden Effekt.
Stefanie:
Das erinnert uns dann an den Rhythmus im Mutterleib, oder? Es geht um Verbindung, um „gemeinsam schwingen“.
Kati:
Ja, absolut. Ich habe das bei meinem Sohn erlebt – er war in einer Musikklasse, in der regelmäßig gemeinsam musiziert wurde. Alle Kinder, waren gleichermaßen eingebunden, auch Kinder mit „herausforderndem Verhalten“ waren ein selbstverständlicher Teil der Gruppe. Diese gemeinsame musikalische Erfahrung hat aus meiner Sicht stark zur sozialen Integration beigetragen.
Stefanie: Es gibt auch Studien, die das belegen. (3)
Gleichzeitig erlebe ich es bei Musiker:innen aber oft umgekehrt: Je höher der eigene Anspruch an sich – etwa im Studium –, desto größer wird das Lampenfieber. Regulation scheint da zu fehlen. Was kann man konkret tun?
Kati:
Ich kenne das von einer Freundin, die im Orchester spielt. Ihr Sitznachbar – ein Trompeter – hat mit Ängsten zu kämpfen. Gerade bei Instrumenten, bei denen man nicht ständig spielt, ist der Druck enorm.
Ich habe ihr z. B. die S-O-S Übungen empfohlen, die ich entwickelt habe – Übungen zur Stressregulation, die bottom-up arbeiten. Drei davon kann man auch im Alltag gut anwenden:
3 Körperübungen für die Selbstregulation
nach Dr. Peter Levine (Somatic Experiencing)
-
Schmetterlingsumarmung: Hände überkreuz auf die Oberarme legen und abwechselnd sanft klopfen.
-
Selbstumarmung: Eine Hand unter die Achsel, die andere auf den Oberarm legen – ein Moment des Halts.
-
Orientierung: Im Raum schöne Dinge zählen – oder auch runde oder eckige Objekte, Köpfe oder Linien. Dadurch erhält das Gehirn wieder mehr Signale aus dem Hier und Jetzt und kann ggf. eine neue Prognose bzgl. der Sicherheits- oder Gefahrenlage treffen.
Stefanie:
Das kenne ich aus der körperorientierten Musikpädagogik – der weite Blick beeinflusst sogar den Klang.
Kati:
Genau. Ein enger, fokussierter Blick signalisiert Anspannung. Wenn der Blick schweift, signalisieren wir uns selbst Sicherheit.
Stefanie:
Du hast noch andere unauffällige Übungen entwickelt, die man sehr diskret machen kann.
Kati:
Ja, z. B. den „kleinen Schmetterling“ (Hände falten, Zeigefinger ausstrecken und Daumen überkreuzen) oder die „Fahrradlenker-Übung“, bei der man Daumen und Zeigefinger wechselseitig umfasst. Diese Übungen sind sehr diskret und lassen sich auch auf der Bühne ausführen – besonders hilfreich bei Lampenfieber.
Stefanie:
Sie wirken so unspektakulär, sind aber erstaunlich effektiv.
Kati:
Ja, dahinter steckt fundiertes neurobiologisches Wissen. Wichtig ist die Reihenfolge – Übungen sollten auf den aktuellen Zustand abgestimmt sein, um das Nervensystem schrittweise „mitzunehmen“.
Stefanie:
Man merkt sofort, wie sich die Stimme verändert.
Du sprichst oft davon, „Regulation in die Welt zu bringen“. Was meinst du damit?
Kati:
Unsere Stimme, Berührung, sogar unser Geruch oder Herzschlag senden Signale an andere. Wenn wir selbst reguliert sind, spüren das auch unsere Kinder. Man kann leichter andere beruhigen, wenn man selbst ruhig ist. Co-Regulation ist ein ständiger wechselseitiger Prozess. Deshalb arbeite ich als Therapeutin oft auch mit den Bezugspersonen, wenn es um Kinder geht.
Stefanie:
Das passiert in gewisser Weise auch mit unserem Publikum bei Konzerten – wir Musiker:innen übertragen etwas über den Klang.
Kati:
Ganz genau. Musik kann das Nervensystem direkt beeinflussen. Es gibt inzwischen Projekte, bei denen Musik an körpereigene Rhythmen angepasst wird, um gezielt das Gefühl von Sicherheit und damit Regulation zu fördern.
Welche drei konkreten Tipps würdest du Eltern mitgeben, um mehr Regulation in den Familienalltag zu bringen?
Kati:
-
Fang bei dir selbst an. Kinder brauchen gute Co-Regulator*innen, über die ihr Nervensystem lernen kann, sich mehr und mehr selbst zu regulieren.
-
Nutze körperliche Übungen. Gerade in stressigen Momenten können die S-O-S Übungen helfen.
-
Hab Geduld mit dir selbst. Es ist ein Prozess. Elternschaft ist Arbeit – auch an sich selbst.
Kati Bohnet
ist Traumatherapeutin und berät online und in ihrer Praxis in Berlin rund um das Thema Trauma und Nervensystem.
Ihr neues Buch "Nervenstark verbunden" erscheint bei Knaur.
Ihr findet sie im Web unter
helperscircle.de und katibohnet.de
und auf Instagram unter @helperscircle.de

Quellen und weiterführende Literatur
(1) Verena König: Trauma und Beziehung, Arkana Verlag, S. 231
"Die Fähigkeit zur Selbstregulation, die sich so viele Menschen wünschen, entwickelt sich durch gelungene Co-Regulation. Eins folgt auf das andere. Wer keine Co-Regulation erfahren hat und sich selbst regulieren möchte, wird das Gleiche erleben wie ein Nichtschwimmer, der ins Wasser springt. Er wird sich erschöpfen und dabei untergehen. Zuerst muss jemand ihm Schwimmen beibringen.
Den wichtigsten Entwicklungsschritt von der Co-Regulation zur Selbstregulation können wir nicht auslassen. Indem wir Menschen, Dinge, Orte und Tätigkeiten in unseren Alltag integrieren, die uns helfen uns zu selbst zu regulieren, schaffen wir eine gute Umgebung, die uns Halt und Sicherheit vermittelt. (…)
Zu lernen das eigene Nervensystem zu regulieren ist Basis und Krönung des Prozesses zugleich."
(2) Eliane Retz: Wild Feelings, Piper S. 19
"Eine Hauptaufgabe von Eltern ist die Regulation von kindlichen Erregungszuständen. Kinder wenden sich beim Empfinden von Wut, Angst und Traurigkeit an eine verfügbare Bindungsperson. Ihre Aufgabe ist es, die Intensität der kindlichen Anspannung zu reduzieren. Im Zusammensein mit seinen Eltern erwirbt das Kind im Laufe seiner Entwiclung dann die Fähigkeit zur Selbstregulation. Dieser Prozess erstreckt sich über einen langen Zeitraum und umfasst die gesamte Kindheit und sogar noch die Jugend."
(3) Prof. Dr. Heiner Gembris/Dr. Ute Welscher: Transfer-Effekte und Wirkungen musikalischer Aktivitäten auf ausgewählte Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung, Ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung, S.6.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/47_MIKA/Gembris_Expertise_final.pdf
Aufgerufen am 30.07.2025
"Zusammenfassend kann man aus jüngeren Forschungsansätze und experimentellen Studien aus den letzten Jahren den empirisch begründeten Schluss ziehen, dass Musik durch rhythmische Spiele, Musizieren und Singen Synchronisierungserfahrungen vermitteln kann, die wiederum prosoziales Verhalten (Hilfsbereitschaft, Kooperation), Empathie, Engagement sowie Gemeinschaftsgefühl und Identifikation mit der Gruppe fördern. Diese Synchronisierungsphänomene konnten bereits bei Kindern im Vorschulalter (2-4 Jahre) nachgewiesen werden. Musikinduzierte Synchronisierungserfahrungen scheinen ein wesentlicher Schlüssel zu positiven Wirkungen auf das Sozialverhalten zu sein. Dieser Zusammenhang ist in früheren Transferstudien nicht untersucht worden. Weiterhin wird in der jüngeren Forschung herausgestellt, dass aktives Musizieren, Musikhören sowie Synchronisierungserfahrung durch Musik Prozesse der Emotionsregulation bewirken können, die zur (Wieder-) Herstellung des emotionalen Gleichgewichts der Persönlichkeit beitragen können. Um diese Erkenntnisse weiter zu untermauern, bedarf es weiterer Forschung. Dennoch bilden die jüngsten Forschungsergebnisse eine vielversprechende Basis für die Erwartung, dass insbesondere musikalische Aktivitäten, die Synchronisierungserfahrungen beinhalten, das Sozialverhalten positiv beeinflussen können."
----
Richard Hortien: Musikunterricht unter sozialpädagogischer Perspektive, Musicalarbeit als Möglichkeit zur Verbesserung des Klassenklimas, Link
----
Matthias Hobmeier: Community Music als pädagogisches Mittel im sonderpädagogischen Schulalltag. Eine empirische Studie zum Einfluss gemeinsamen Sambatrommelns auf aggressives Verhalten, Gruppendynamik und Musikalität., Link

Ich bin Stefanie
Als Diplom-Musikpädagogin begleite ich Eltern nach meinem Musilienz-Ansatz dabei, ihre eigene musikalische Begabung = Wahrnehmung zu entwickeln, Musik zu ihrer Kraft- und Balancequelle im Alltag zu machen und musikalische Ausgeglichenheit an ihre Kinder weiterzugeben. Mehr zu meiner Arbeit …

.png)


